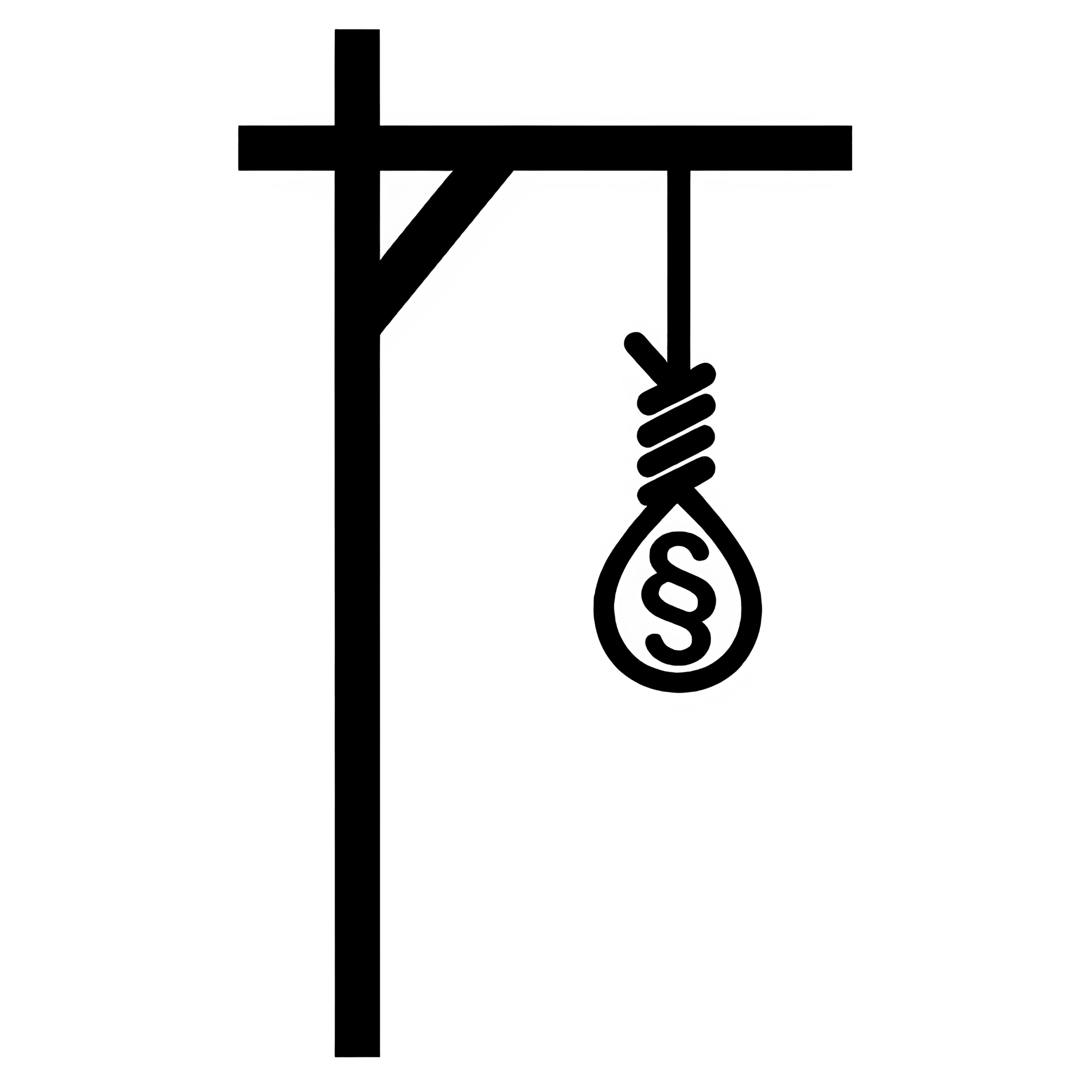Einleitung:
Ein Staat, der sich selbst gern als robust darstellt, reagiert bei Kritik manchmal wie Porzellan im Härtetest: klirrend, empfindlich, schnell mit dem Strafrecht zur Hand. Genau an dieser Bruchstelle steht § 188 StGB – ein Sondertatbestand für „Personen des politischen Lebens“, amtlich nachlesbar in der Gesetzesfassung bei „Gesetze im Internet“ (BMJ). Und genau dort setzt Jens Spahn an: Er will diesen Paragrafen streichen lassen – ausgerechnet ein Schutzinstrument, das politisch lange mit dem Argument der Funktionsfähigkeit und der Abschirmung gegen Verrohung verteidigt wurde. Der Bundestag hat die Abschaffung von § 188 StGB bereits 2025 in einer Plenardebatte thematisiert (Textarchiv des Deutschen Bundestages vom 12.09.2025). Was hier passiert, wirkt wie ein Rollenwechsel: vom geschützten Amt zur angeblich überflüssigen Schutzschicht.
Hauptteil:
Wenn der Staat seinen eigenen Schutzreflex politisiert
§ 188 StGB ist kein „Ersatz“ für die normalen Ehrschutzdelikte, sondern ein Zusatz mit engeren Voraussetzungen: Öffentlichkeit, Verbreitung und die Eignung, das öffentliche Wirken erheblich zu erschweren. Genau dieser Zusatz ist politisch brisant, weil er nicht nur eine Person schützt, sondern indirekt die Funktion – also die politische Tätigkeit. Juristisch lässt sich das als Schutz der demokratischen Arbeitsfähigkeit lesen; politisch kann es als Aufrüstung des Staates gegen verbale Angriffe verstanden werden. Spahn begründet seine Forderung laut Presseberichten damit, der Paragraf erzeuge den Eindruck eines Sonderrechts für „die Mächtigen“ und verfehle damit seinen ursprünglichen Zweck, insbesondere kommunale Mandatsträger zu schützen. Diese Argumentation ist eine Machtkommunikation: Wer das Sonderrecht abschafft, kann sich als „gleich wie alle“ inszenieren, ohne die reale Schieflage in der Debatte um Strafanzeigen, Verfolgungsdruck und politische Empörungskultur automatisch zu lösen.
Gleichheit vor dem Gesetz endet nicht beim Mikrofon
Die Kernbehauptung „Beleidigung ist doch ohnehin strafbar“ ist juristisch korrekt: § 185 StGB gilt für alle, ebenso üble Nachrede und Verleumdung (§§ 186, 187 StGB). Der Streit dreht sich daher nicht um die Existenz von Strafbarkeit, sondern um die besondere Qualifikation und Signalwirkung. § 188 sagt: Angriff auf politisches Wirken ist mehr als private Kränkung. Das kann man als Schutz der Debatte verteidigen – oder als Privilegierung kritisieren. Spahns Wendung trifft damit einen Nerv: Wer politische Macht verwaltet, braucht Vertrauen; Sondernormen, die wie Sonderstatus wirken, können dieses Vertrauen beschädigen. Gleichzeitig darf man nicht so tun, als sei damit die Bedrohungslage verschwunden: Hasskampagnen, koordinierte Diffamierung und digitale Dauerbeschallung treffen besonders sichtbar handelnde Personen. Der Punkt ist: Gleichheit vor dem Gesetz ist nicht nur ein juristischer Satz, sondern ein sozialer Vertrag – und der zerreißt, wenn Schutzrechte wie Standesabzeichen wirken.
Der unsichtbare Hebel heißt Strafverfolgungsvoraussetzung
Die eigentliche Schärfe liegt nicht nur im Paragrafen, sondern im Zusammenspiel mit Verfolgungsmechanismen: Wann wird ermittelt, wann braucht es einen Antrag, wann genügt „öffentliches Interesse“? In der Debatte um § 188 wird genau diese Schwelle als Machtfaktor wahrgenommen, weil sie darüber entscheidet, ob Kritik schnell in ein Verfahren kippt. Das ist kein Freibrief für Beschimpfung, sondern eine Strukturfrage: Das Strafrecht ist ein scharfes Instrument, und die Frage ist, wessen Alltag damit schneller erreicht wird. Wenn politisch Handelnde zugleich häufiger im Zentrum öffentlicher Auseinandersetzung stehen, entsteht ein Spannungsfeld: Einerseits braucht Demokratie Schutz vor Einschüchterung, andererseits braucht sie maximale Reibungstoleranz. Spahns Position – so wie sie über Medien überliefert ist – kann deshalb als Versuch gelesen werden, die Schwelle symbolisch zurückzuverlegen: weg vom Sondertatbestand, hin zum allgemeinen Ehrschutz. Ob das praktisch Entlastung bringt oder nur die Optik korrigiert, bleibt eine offene empirische Frage.
Kommunale Ebene als Begründung und als Alibi
Die politische Standarderzählung lautet: § 188 sei ein Schutz für diejenigen, die im Rathaus, im Kreistag oder im Ortsbeirat Zielscheiben werden. Das ist plausibel, weil gerade kommunale Mandatsträger häufig ohne große Sicherheitsinfrastruktur arbeiten. Doch genau diese Begründung kann zur Schutzhülle werden, hinter der sich ein generelles Sonderrecht für prominente Funktionsinhaber etabliert – jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung. Spahn sagt laut Berichterstattung, die Idee sei Schutz gewesen, entstanden sei aber der Eindruck eines Privilegs. Diese Diagnose ist politisch klug, weil sie das Legitimationsproblem benennt: Wenn ein Instrument als Selbstschutz der Institution gelesen wird, verliert es seine Akzeptanzbasis. Gleichzeitig bleibt ein Widerspruch bestehen: Wer ernsthaft die kommunale Ebene schützen will, muss mehr liefern als Symbolpolitik. Denn digitale Hetze funktioniert nicht entlang von Amtsstufen, sondern entlang von Sichtbarkeit. Wenn § 188 fällt, entscheidet sich der Schutz nicht automatisch zugunsten „der Kleinen“, sondern hängt weiter davon ab, ob und wie konsequent Staatsanwaltschaften, Plattformen und Behörden Strukturen der Einschüchterung verfolgen.
Meinungsfreiheit ist kein Freifahrtschein und kein Maulkorb
Im Zentrum steht Art. 5 GG als gesellschaftlicher Resonanzraum: Meinungsfreiheit schützt auch scharfe, verletzende Kritik, aber nicht jede Form der Ehrverletzung. Der Staat muss beides aushalten: harte politische Sprache und die Notwendigkeit, Grenzen zu ziehen, wenn aus Kritik eine gezielte Zerstörung von Person und Teilhabe wird. § 188 beansprucht, diese Grenze dort zu markieren, wo politisches Wirken „erheblich erschwert“ werden kann; seine Kritiker sehen darin eine staatliche Empfindlichkeit mit Strafandrohung. Spahns Abschaffungsforderung – nach der derzeit verfügbaren, nicht amtlichen Überlieferung aus Presseinterviews – greift genau diesen Konflikt auf: Er will den Eindruck beenden, dass Amtsmacht sich ein zusätzliches Schutzpolster organisiert. Die offene Flanke bleibt: Ohne tragfähige, transparente Kriterien und ohne belastbare Praxisdaten wird die Debatte moralisch aufgeladen statt sachlich geführt. Und genau das ist der eigentliche Schaden: Eine Demokratie, die ihre Konflikte nur noch über Strafnormen und Empörungsrituale verhandelt, verliert zuerst die Nüchternheit – und dann die Zustimmung.
Verbesserungsvorschlag:
Wenn § 188 StGB abgeschafft werden soll, braucht es eine saubere Ersatzlogik, sonst wird aus der Korrektur der Symbolik eine Verschlechterung der Praxis. Erstens sollte der Gesetzgeber den allgemeinen Ehrschutz (§§ 185–187 StGB) nicht „verschärfen“, sondern prozessual klären: transparente Leitlinien zur Verfolgung bei massenhafter digitaler Diffamierung, die nicht auf Prominenz, sondern auf Intensität, Reichweite und Koordinierung abstellen. Das würde den Funktionsschutz nicht über Amtsstatus definieren, sondern über die reale Angriffslage. Zweitens gehört § 194 StGB (Strafantrag/öffentliches Interesse) in die öffentliche Debatte: Nicht als Insider-Detail, sondern als demokratische Kontrollfrage. Ein nachvollziehbares, bundeseinheitliches Berichtswesen (ohne personenbezogene Details) könnte offenlegen, wie oft Ehrschutzdelikte eingestellt, angeklagt oder verurteilt werden, getrennt nach Deliktgruppen und Verbreitungsformen. Drittens muss Schutz dort ansetzen, wo Verrohung erzeugt wird: Plattformdurchsetzung, schnelle Beweissicherung, klare Zuständigkeiten bei digitaler Gewalt, und eine konsequente Trennung zwischen strafbarer Ehrverletzung und zulässiger politischer Kritik. Das Ziel wäre nicht ein neuer Sonderparagraf, sondern ein Verfahren, das gleich wirkt: Wer gezielt einschüchtert, wird verfolgt – wer hart kritisiert, bleibt frei. So entsteht Schutz ohne Standesvorteil, und Meinungsfreiheit ohne Zynismus.
Schluss:
Spahns Vorstoß zeigt weniger eine plötzliche Liebe zur Gleichheit, sondern vor allem die Sprengkraft von Symbolrecht: Ein Paragraf, der Schutz verspricht, kann als Privileg gelesen werden – und damit Vertrauen zerstören, statt es zu sichern. Wer § 188 StGB streicht, muss deshalb erklären, wie Einschüchterung, Kampagnen und digitale Diffamierung praktisch bekämpft werden, ohne die Schwelle zur Strafverfolgung zum politischen Spielball zu machen. Denn die Alternative zur Sondernorm darf nicht die Normalisierung der Verrohung sein. Eine Demokratie beweist Stärke nicht dadurch, dass sie jede Beleidigung bestraft, sondern dadurch, dass sie Regeln so setzt, dass Macht nicht empfindlicher ist als die Menschen, die sie verwaltet. Der Lackmus-Test ist simpel: Gleiche Maßstäbe, gleiche Transparenz, gleiche Konsequenz – für alle.
Rechtlicher Hinweis:
Dieser Beitrag verbindet Fakten mit journalistischer Analyse und satirischer Meinungsäußerung. Alle Tatsachenangaben beruhen auf nachvollziehbaren, öffentlich zugänglichen Quellen; die Einordnung und Bewertung stellt eine subjektive, politisch-satirische Analyse dar. Die Inhalte dienen der Aufklärung, der Kritik und der politischen Bildung und sind im Rahmen von Art. 5 GG geschützt.
Systemkritik.org distanziert sich ausdrücklich von Diskriminierung, Extremismus, religiösem Fanatismus und jeglicher Form von Gewaltverherrlichung.