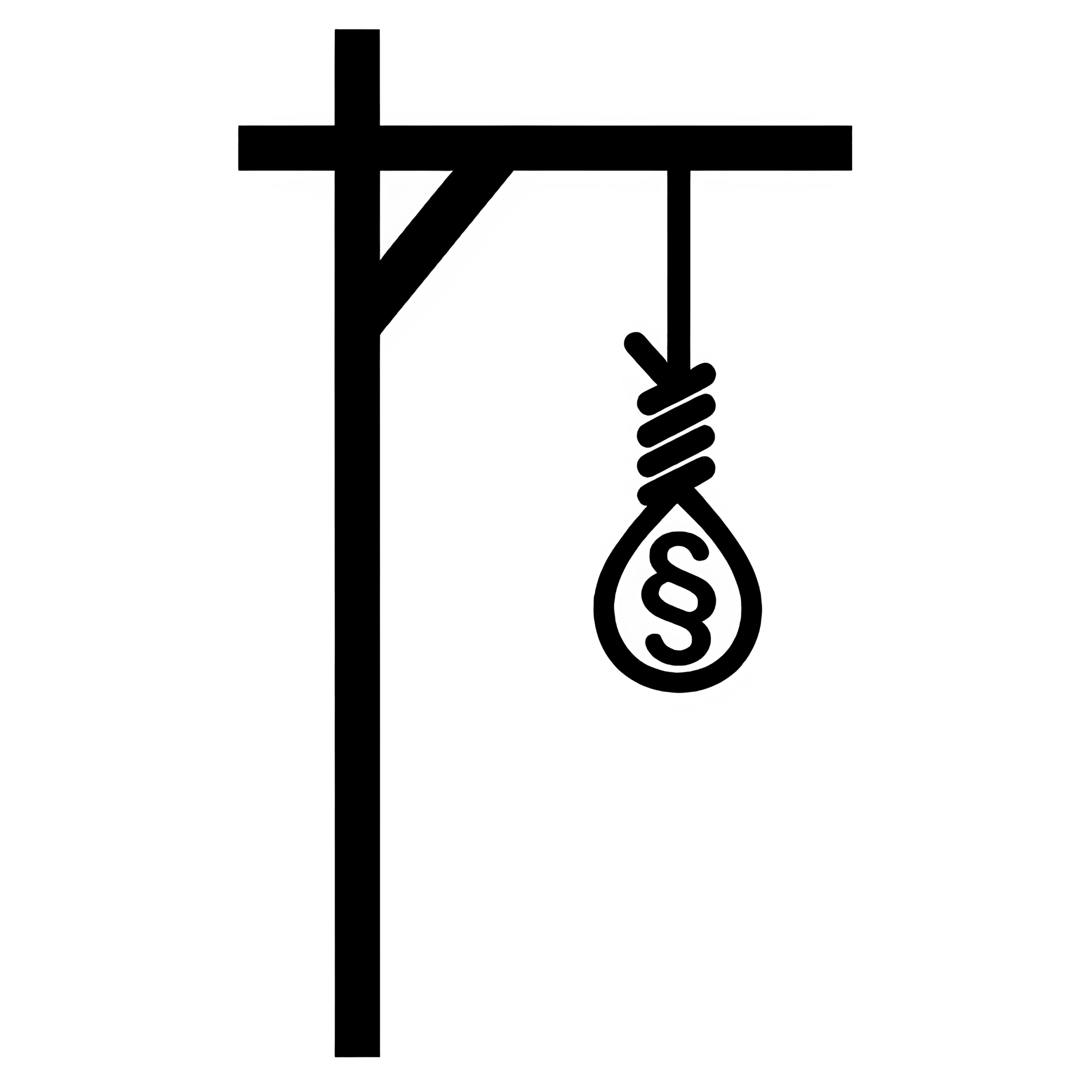Einleitung:
Manchmal riecht ein „Wohnangebot“ nicht nach Zuhause, sondern nach Kalkül: Räume, die nach Aktenlage kaum bewohnbar wirken, werden zu Renditeflächen erklärt – und Menschen zu Positionsnummern in einer Mieteinnahme-Tabelle. Genau diese Gemengelage beschreibt der Antrag „Wohnraum sichern, Immobilien nutzbar machen – Stopp von sogenannten Schrottimmobilien“ (Bundestags-Drucksache 21/3615): verwahrloste oder leerstehende Gebäude, die trotz Wohnraummangel nicht nutzbar gemacht werden, zugleich aber als Unterbringungsorte für Arbeitsmigrantinnen und -migranten oder Transferleistungsbeziehende dienen – mit Vorwürfen wie überhöhten Mieten, Mehrfachbelegung, Scheinanmeldungen und gezieltem Umgehen von Kontrollen. Wer das liest, versteht: Das ist kein Einzelfall-Drama, sondern ein Streit um Macht, Zuständigkeit und den Preis sozialer Verwundbarkeit.
Hauptteil:
Wenn Wohnraum zur Verwertungszone wird
Der Antrag zeichnet ein Bild, das in einer funktionierenden Wohnpolitik eigentlich nicht vorkommen dürfte: Gebäude, die „dauerhaft verwahrlost“ oder „unbewohnbar“ erscheinen, werden nicht saniert, nicht genutzt, nicht dem Markt entzogen – sie werden verwertet. Nicht als Wohnraum im Sinne von Würde, sondern als Fläche, auf der sich mit Notlagen Geld verdienen lässt. Laut BT-Drs. 21/3615 geht es dabei ausdrücklich auch um Konstellationen, in denen Unterbringung mit Ausbeutung verknüpft ist: überhöhte Mieten, mehrere Personen pro Zimmer, Konstruktionen, die Adressanmeldungen und Leistungsbezug ermöglichen. Das ist nicht zwingend „der große kriminelle Plan“ – aber es ist ein System, das Fehlanreize produziert und den Preis externalisiert: auf Betroffene, Nachbarschaften und Kommunen. Und es ist ein System, das sich hinter Eigentumssätzen verschanzt, während es soziale Schäden erzeugt.
Kontrolllücken als Geschäftsgrundlage
Der Text benennt ein Muster: nicht fehlende Regeln, sondern die Kunst, zwischen Zuständigkeiten zu verschwinden. Wenn Mietwucherfragen, baurechtliche Mängel, Meldeformalitäten und Sozialleistungsprüfungen getrennt nebeneinander laufen, entsteht ein administratives Niemandsland. Genau dort gedeihen Modelle, die auf „Behördenkontrollen gezielt umgehen“ setzen, wie es der Antrag beschreibt. Man muss nicht behaupten, jede solche Immobilie sei automatisch Betrug – das wäre unseriös. Aber man kann nüchtern feststellen: Wo Kontrollen zersplittert sind, wird Kontrolle zur Ausnahme. Und wo Kontrolle zur Ausnahme wird, lohnt sich Grenzüberschreitung betriebswirtschaftlich. Das ist die kalte Logik: nicht Moral, sondern Risiko-Nutzen-Kalkulation. Der Antrag fordert deshalb eine bessere Verzahnung von Bau-, Sozial- und Finanzkontrollen, weil das Problem genau in dieser Trennung sitzt.
Kommunen im Dauerstress der Zuständigkeiten
Die Kommunen stehen dabei nicht als „unfähig“ im Text, sondern als überfordert – und zwar strukturell. BT-Drs. 21/3615 nennt fehlende Eingriffsbefugnisse, lange Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, Kostenverlagerung auf Städte und Gemeinden sowie die mangelnde Durchsetzung bestehenden Bau- und Ordnungsrechts. Das ist der Klassiker staatlicher Praxis: Verantwortung wird nach unten gereicht, Instrumente bleiben oben hängen, und am Ende soll die örtliche Behörde aus Papierkompetenz reale Durchsetzung bauen. Wenn Verfahren Jahre dauern, verfestigt sich Missstand als Normalzustand. Wenn Standards fehlen oder nicht greifen, entsteht ein Marktsegment, das von der Entwürdigung lebt. Und wenn die Rechnung bei der Kommune landet, ist die politische Botschaft klar: Soziale Folgeschäden sind „lokal“, Renditen privat. Das ist nicht nur ungerecht, es macht auch kommunale Handlungsfähigkeit zur Verhandlungsmasse.
Eigentum verpflichtet oder Eigentum entzieht sich
Der Antrag greift bewusst den verfassungsrechtlichen Kern an: Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz („Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“). Das ist keine Dekozeile, sondern der Maßstab, an dem sich die Debatte entzündet. Wenn eine Immobilie dauerhaft verwahrlost, leersteht oder als Unterbringungsort unter Bedingungen genutzt wird, die Mindeststandards berühren, dann ist die Frage nicht nur „darf man da eingreifen?“, sondern „warum greift man nicht konsequent ein?“. BT-Drs. 21/3615 fordert u. a. stärkere kommunale Zugriffsrechte bis hin zur erleichterten Überführung in öffentliche Hand bei dauerhaftem Missbrauch oder Verwahrlosung. Das ist politisch konfliktträchtig, weil es Eigentumsfreiheit spürbar begrenzt. Aber genau darum geht es: ob Eigentum als Schutzschild für Verwahrlosung funktioniert – oder als Verpflichtung, Wohnraum tatsächlich nutzbar zu machen.
Parlamentarischer Betrieb trifft Lebensrealität
Formal ist der Vorgang sauber verortet: Erste Beratung am 16.01.2026, Überweisung in die Ausschüsse (federführend: Bauausschuss), dokumentiert im Plenarprotokoll 21/54. Diese Verfahrensroutine wirkt nüchtern – während die beschriebenen Lagen alles andere als nüchtern sind. Der Text spricht von Unterbringung, die mit Ausbeutungsstrukturen zusammenhängt; von Immobilien, die im Kontext von Scheinanmeldungen oder Sozialleistungsbetrug auffallen; von Kontrollen, die umgangen werden. Das ist politisch nicht „nur“ Wohnungsbau, sondern eine Schnittstelle aus Wohnen, Arbeit, Migration, Sozialstaat und lokaler Ordnung. Wer hier nur über Quadratmeter redet, redet am Problem vorbei. Denn der Kern ist: Wo Wohnen zur Druckstelle wird, wird der Sozialstaat erpressbar – entweder er schaut weg, oder er muss teuer reparieren. Und genau diese Reparaturkosten landen laut Antrag häufig bei den Kommunen.
Verbesserungsvorschlag:
Wenn der Antrag ein Vollzugsproblem markiert, muss die Antwort vor allem Vollzug organisieren – ohne neue Nebelkerzen. Erstens: Kommunale Eingriffsbefugnisse sollten so gestaltet werden, dass sie nicht an jahrelangen Verfahren verhungern. Das heißt nicht „rechtsstaatliche Abkürzung“, sondern priorisierte, spezialisierte Verfahren für Fälle dauerhafter Verwahrlosung, unzumutbarer Unterbringung oder systematischen Leerstands trotz Wohnraummangels, wie sie BT-Drs. 21/3615 beschreibt. Zweitens: Die geforderte Verzahnung von Bau-, Sozial- und Finanzkontrollen braucht feste, gemeinsame Prüfroutinen mit klaren Auslösern (z. B. wiederholte Mängelmeldungen, auffällige Belegungsdichten, wiederkehrende Adresskonstellationen) und eindeutige Zuständigkeit: eine koordinierende Stelle, die nicht „berät“, sondern anordnet und dokumentiert. Drittens: Mindeststandards bei Unterbringung müssen nicht nur als Norm existieren, sondern als prüfbarer Standardkatalog mit messbaren Kriterien – damit „unzumutbar“ nicht zur Meinungssache wird. Viertens: Wenn Kosten systematisch bei Kommunen landen, braucht es einen Mechanismus, der diese Lasten nicht weiter nach unten drückt: Wer nachweislich durch Verwahrlosung, Missbrauch oder Umgehung von Kontrollen Folgekosten erzeugt, muss konsequent mit Kostenbescheiden, Auflagen und – wo verhältnismäßig – mit der im Antrag diskutierten Überführung in öffentliche Hand konfrontiert werden. Der verfassungsrechtliche Rahmen (Art. 14 Abs. 2 GG) ist dafür nicht Hindernis, sondern Begründung: Eigentum ist kein Freibrief, sondern eine soziale Verpflichtung – und die muss praktisch durchsetzbar werden.
Schluss:
Man kann das Ganze „Schrottimmobilien“ nennen, man kann es technokratisch „Problembestände“ titulieren – aber die Realität bleibt dieselbe: Wenn Verwahrlosung, Leerstand und ausbeutungsnahe Unterbringung sich lohnen, kippt Wohnraum aus dem Gemeinwohl heraus. Der Antrag BT-Drs. 21/3615 legt den Finger in diese Wunde, und das Plenum hat den Vorgang in den üblichen Ausschusslauf geschickt. Jetzt entscheidet sich, ob der Staat weiter zusieht, wie Zuständigkeiten als Schutzwände funktionieren – oder ob er Eigentumspflichten so ernst nimmt, dass Ausweichstrategien unattraktiv werden. Wohnraum ist zu knapp, um ihn als Rendite-Nische für Missstände zu dulden. Wer Menschen verwaltet wie Inventar, baut kein Zuhause – er baut ein Geschäft auf Kosten der Gesellschaft.
Rechtlicher Hinweis:
Dieser Beitrag verbindet Fakten mit journalistischer Analyse und satirischer Meinungsäußerung. Alle Tatsachenangaben beruhen auf nachvollziehbaren, öffentlich zugänglichen Quellen; die Einordnung und Bewertung stellt eine subjektive, politisch-satirische Analyse dar. Die Inhalte dienen der Aufklärung, der Kritik und der politischen Bildung und sind im Rahmen von Art. 5 GG geschützt.
Systemkritik.org distanziert sich ausdrücklich von Diskriminierung, Extremismus, religiösem Fanatismus und jeglicher Form von Gewaltverherrlichung.