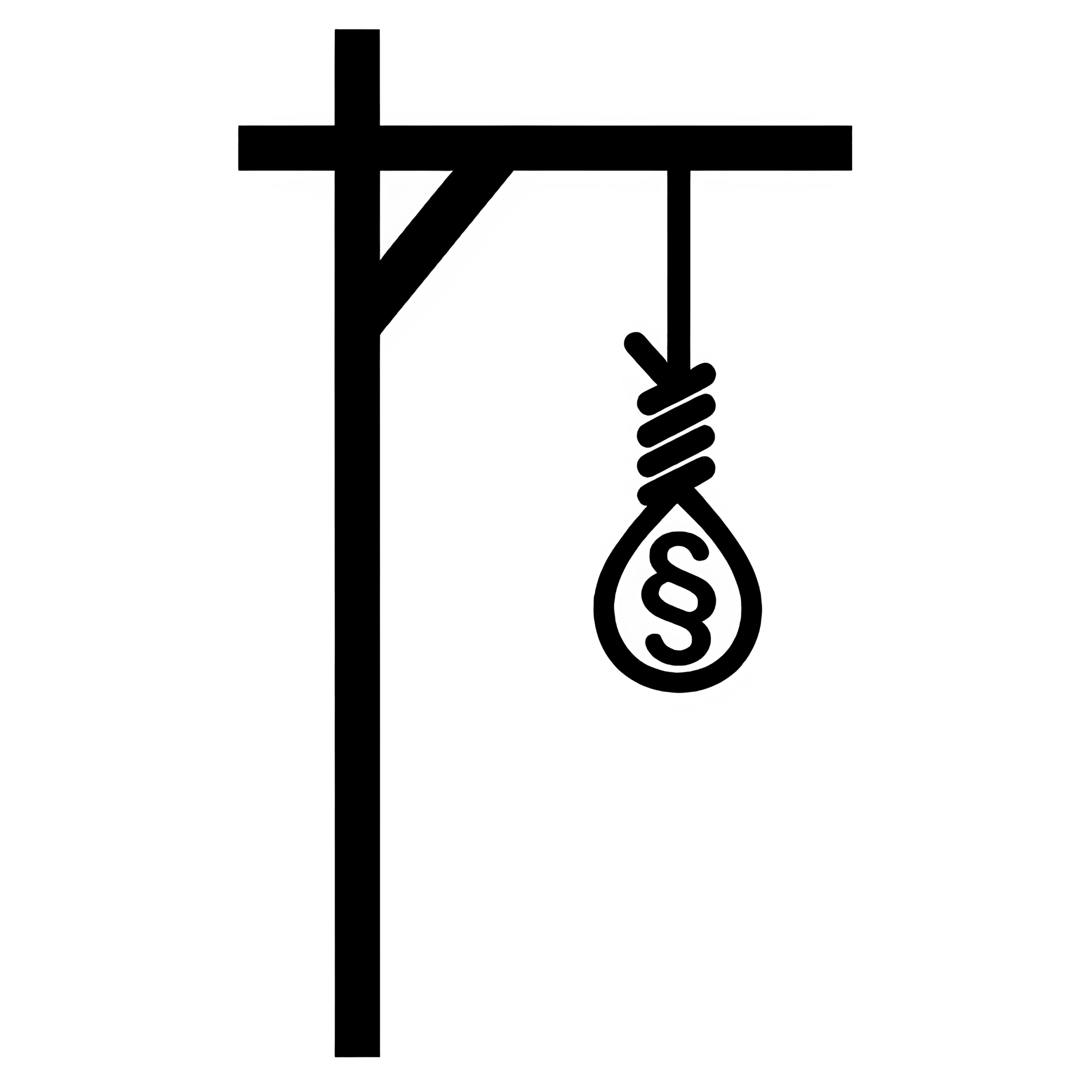Einleitung:
Das Leistungsprinzip galt lange als stillschweigende Übereinkunft dieser Gesellschaft: Wer arbeitet, soll vorankommen. Wer erbt, soll sich zumindest erklären müssen. Doch im Parlament verschiebt sich der Maßstab. Mit Vorstößen zur Abschaffung oder Nichterhebung der Erbschaft- und Schenkungsteuer wird ein System verteidigt, das Vermögen schützt, bevor es Verantwortung einfordert. Das Bild ist klar: Vermögen wandert, Arbeit bleibt zurück. Die politische Debatte dazu ist kein Randthema, sondern ein Frontalangriff auf eine der letzten symbolischen Grenzen zwischen Leistung und Besitz. Gegenstand der aktuellen Plenarberatung sind ein Antrag zur Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie die Ankündigung eines Gesetzentwurfs zur Nichterhebung dieser Steuer. Belegt ist dies durch die Amtliche Tagesordnung des Bundestages sowie die Bundestagsdrucksache 21/2804. Der parlamentarische Vorgang ist dokumentiert, der Konflikt offen. Dieser Beitrag ist eine analytisch-satirische Einordnung dieser Entwicklung – als Kommentar zur politischen Richtung, nicht als Tatsachenbericht.
Hauptteil:
Vermögen ohne Leistung als politisches Leitbild
Der parlamentarische Vorstoß zur Abschaffung oder Nichterhebung der Erbschaft- und Schenkungsteuer markiert mehr als eine steuerpolitische Detailfrage. Er setzt ein Signal darüber, welches ökonomische Verhalten politisch belohnt wird. Während Arbeitseinkommen regelmäßig besteuert, geprüft und sanktioniert wird, sollen große Vermögensübertragungen künftig vollständig aus dem Zugriff des Staates genommen werden. Das Leistungsprinzip wird damit nicht offen abgeschafft, aber faktisch relativiert. Wer Vermögen erbt, wird von jeder gesellschaftlichen Gegenleistung entkoppelt. Die Begründungslogik des Antrags stützt sich auf das Argument der sogenannten Doppelbesteuerung. Diese Darstellung blendet jedoch aus, dass Erbschaften kein Einkommen aus eigener Leistung darstellen, sondern eine privilegierte Vermögensposition fortschreiben. Politisch relevant ist dabei weniger die steuertechnische Frage als die normative Botschaft: Besitz soll geschützt werden, unabhängig von seiner Herkunft. Der Staat zieht sich aus der moderierenden Rolle zurück und akzeptiert Vermögenskonzentration als gegebenen Zustand. Institutionell bedeutet das eine Verschiebung der Prioritäten. Steuergerechtigkeit wird neu definiert – nicht entlang gesellschaftlicher Leistungsfähigkeit, sondern entlang bestehender Besitzverhältnisse. Der parlamentarische Raum wird so zum Ort, an dem Ungleichheit nicht mehr begrenzt, sondern verwaltet wird.
Parlamentarische Normalisierung von Ungleichheit
Dass ein Antrag zur vollständigen Abschaffung einer Steuerart im Plenum behandelt wird, ist an sich kein Skandal. Skandalös wird es dort, wo diese Forderung als Ausdruck von „Steuerfairness“ gerahmt wird. Der parlamentarische Diskurs verschiebt Begriffe, bis sie ihr Gegenteil bedeuten. Fairness wird nicht mehr an gesellschaftlicher Balance gemessen, sondern an der Schonung vermögender Gruppen. Diese Verschiebung ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer langfristigen Normalisierung sozialer Ungleichheit im politischen Betrieb. Der Antrag selbst benennt das Steueraufkommen der Erbschaft- und Schenkungsteuer für das Jahr 2024 mit 13,3 Milliarden Euro. Diese Zahl steht im Raum, ohne dass eine belastbare Gegenfinanzierung eingefordert wird. Der Wegfall dieser Einnahmen wird politisch entdramatisiert, als handle es sich um eine vernachlässigbare Größe. Damit wird Haushaltsrealität bewusst ausgeblendet. Die parlamentarische Auseinandersetzung verliert den Bezug zu den realen Konsequenzen für öffentliche Aufgaben, Infrastruktur und soziale Sicherung. Systemisch betrachtet zeigt sich hier ein Muster: Einnahmeausfälle werden akzeptiert, wenn sie Vermögen betreffen. Sparzwänge und Konsolidierungsargumente greifen hingegen regelmäßig dort, wo Leistungen für breite Bevölkerungsschichten verhandelt werden. Das Parlament reproduziert so eine asymmetrische Belastungslogik – strukturell, nicht zufällig.
Steuerpolitik als Schutzschild bestehender Machtstrukturen
Erbschaftsteuerpolitik ist nie neutral. Sie berührt unmittelbar die Frage, wie ökonomische Macht über Generationen hinweg gesichert oder begrenzt wird. Mit der Forderung nach Abschaffung oder Nichterhebung dieser Steuer wird ein Instrument aufgegeben, das zumindest theoretisch geeignet ist, Vermögenskonzentration zu dämpfen. Der parlamentarische Vorstoß signalisiert damit eine bewusste Entscheidung zugunsten der Stabilisierung bestehender Machtverhältnisse. Vermögen bleibt dort, wo es ist, und wird politisch abgesichert. Besonders deutlich wird dies im Kontext von Betriebsvermögen und Unternehmensnachfolge. Hier existieren bereits weitreichende Ausnahmen und Privilegierungen, die in früheren Reformen immer wieder verfassungsrechtlich problematisiert wurden. Anstatt diese Strukturen kritisch zu überprüfen, wird nun der nächste Schritt gegangen: die grundsätzliche Infragestellung der Steuer selbst. Das Parlament verschiebt die Debatte von der Ausgestaltung zur Abschaffung und entzieht sich damit der Verantwortung für eine differenzierte Lösung. Gesellschaftlich wirkt diese Entscheidung wie ein Schutzschild. Ökonomische Macht wird nicht als Risiko für demokratische Balance verstanden, sondern als schützenswerte Konstante. Die Steuerpolitik verliert damit ihre korrigierende Funktion und wird zum Instrument der Besitzstandswahrung.
Gesellschaftliche Folgen einer steuerpolitischen Kapitulation
Die Abschaffung oder Nichterhebung der Erbschaft- und Schenkungsteuer bleibt nicht folgenlos für die gesellschaftliche Wahrnehmung von Leistung und Gerechtigkeit. Wenn Vermögen steuerfrei übertragen werden kann, während Arbeitseinkommen dauerhaft belastet wird, verschiebt sich das soziale Koordinatensystem. Leistung verliert ihren normativen Stellenwert, Herkunft gewinnt an Bedeutung. Der soziale Aufstieg wird nicht gefördert, sondern ersetzt durch die Stabilisierung bestehender Vermögenslagen. Diese Entwicklung wirkt langfristig auf das Vertrauen in staatliche Institutionen. Steuerpolitik ist immer auch ein Signal darüber, wessen Interessen politisch geschützt werden. Wird der Eindruck verfestigt, dass parlamentarische Entscheidungen systematisch zugunsten vermögender Minderheiten ausfallen, untergräbt dies die Legitimität demokratischer Verfahren. Die politische Ordnung erscheint dann nicht mehr als ausgleichend, sondern als parteiisch. Im Ergebnis entsteht eine Gesellschaft, in der ökonomische Startbedingungen zunehmend über Lebensverläufe entscheiden. Der parlamentarische Beschuss des Leistungsprinzips ist damit kein abstrakter Diskurs, sondern eine konkrete Weichenstellung. Er definiert neu, was als gerecht gilt – und akzeptiert Ungleichheit nicht mehr als Problem, sondern als Normalzustand.
Leistungsprinzip als rhetorische Hülle politischer Entscheidungen
Im parlamentarischen Diskurs wird das Leistungsprinzip regelmäßig beschworen, zugleich jedoch schrittweise entleert. Der Vorstoß zur Abschaffung oder Nichterhebung der Erbschaft- und Schenkungsteuer macht diesen Widerspruch sichtbar. Leistung wird rhetorisch gefeiert, aber politisch folgenlos gestellt, sobald sie mit der Frage nach Vermögensverteilung kollidiert. Der Begriff dient als moralische Kulisse, hinter der konkrete Entscheidungen getroffen werden, die mit Leistung im engeren Sinne nichts mehr zu tun haben. Diese Entkopplung ist systemisch relevant. Wenn politische Entscheidungen Vermögensübertragungen privilegieren, während Erwerbsarbeit weiterhin als primäre Finanzierungsquelle öffentlicher Aufgaben dient, entsteht eine strukturelle Schieflage. Das Parlament sendet damit ein doppeltes Signal: Arbeit ist Pflicht, Besitz ist Schutzgut. Die soziale Erzählung von Leistungsgerechtigkeit bleibt bestehen, verliert aber ihre materielle Grundlage. Langfristig wirkt diese Logik stabilisierend für bestehende Ungleichheiten. Das Leistungsprinzip wird nicht abgeschafft, sondern funktional umgedeutet – vom Maßstab gesellschaftlicher Teilhabe zum Legitimationsinstrument politischer Untätigkeit gegenüber Vermögenskonzentration. Genau darin liegt seine neue parlamentarische Rolle.
Verbesserungsvorschlag
Eine realistische und umsetzbare Alternative zur vollständigen Abschaffung oder Nichterhebung der Erbschaft- und Schenkungsteuer liegt nicht im Entweder-oder, sondern in einer strukturellen Neuausrichtung. Ausgangspunkt muss die Anerkennung sein, dass diese Steuer kein Strafinstrument ist, sondern ein ordnungspolitisches Korrektiv. Ziel wäre eine Reform, die kleine und mittlere Vermögensübertragungen entlastet, hohe Vermögen jedoch konsequent einbezieht. Damit würde der häufig vorgebrachten Sorge um familiäre Existenzen Rechnung getragen, ohne die gesamtgesellschaftliche Ausgleichsfunktion aufzugeben. Konkret bedeutet das: deutlich erhöhte persönliche Freibeträge für nahe Angehörige, gekoppelt mit einer progressiven Besteuerung großer Vermögensübertragungen. Betriebsvermögen könnten weiterhin geschützt werden, jedoch nur unter klaren, überprüfbaren Bedingungen wie Beschäftigungssicherung und tatsächlicher Fortführung des Unternehmens. Pauschale Privilegien ohne Nachweispflichten würden entfallen. Gleichzeitig wäre eine Vereinfachung der Bewertungsverfahren notwendig, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren – ein Argument, das im Antrag selbst angeführt wird. Eine solche Reform würde weder utopisch noch systemfremd sein. Sie würde das Leistungsprinzip nicht rhetorisch beschwören, sondern praktisch stärken, indem sie Herkunft begrenzt und gesellschaftliche Verantwortung einfordert. Der Staat bliebe handlungsfähig, Einnahmen würden gesichert, und die Steuerpolitik würde wieder als Instrument der Balance wirken – nicht als Kapitulation vor Vermögen.
Schluss:
Die parlamentarische Debatte um die Erbschaft- und Schenkungsteuer ist mehr als ein fiskalischer Streit. Sie zeigt, wie sich politische Maßstäbe verschieben, wenn Besitz zum schützenswerten Prinzip erklärt wird und Leistung zur Nebensache gerät. Wird diese Logik fortgeschrieben, entsteht eine Ordnung, in der Ungleichheit nicht mehr korrigiert, sondern verwaltet wird – kühl, effizient und demokratisch legitimiert. Der Beschuss des Leistungsprinzips erfolgt dabei nicht laut, sondern formal korrekt, eingebettet in Anträge und Tagesordnungspunkte. Genau darin liegt seine Wirkung. Wer heute Steuerverzicht beschließt, entscheidet über die Gesellschaft von morgen. Die Frage ist nicht, ob sich der Staat das leisten kann, sondern wem er es leisten will.
Rechtlicher Hinweis:
Dieser Beitrag verbindet Fakten mit journalistischer Analyse und satirischer Meinungsäußerung. Alle Tatsachenangaben beruhen auf nachvollziehbaren, öffentlich zugänglichen Quellen; die Einordnung und Bewertung stellt eine subjektive, politisch-satirische Analyse dar. Die Inhalte dienen der Aufklärung, der Kritik und der politischen Bildung und sind im Rahmen von Art. 5 GG geschützt.
Systemkritik.org distanziert sich ausdrücklich von Diskriminierung, Extremismus, religiösem Fanatismus und jeglicher Form von Gewaltverherrlichung.